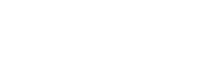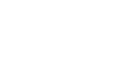22.12.2023
Abschluss PAE Lycaena helle 2018 – 2023
Zu 100 % vom Umweltministerium finanziert, wurden zwischen 2018 und 2023 unterschiedliche Maßnahmen zum Schutz des Blauschillernden Feuerfalters (Lycaena helle) umgesetzt. Diese kleine Schmetterlingsart kommt ausschließlich im Ösling vor und dies nur in geringer Individuenanzahl und in wenigen Gebieten.
Durch das Projekt sollten die bestehenden Vorkommen gepflegt und ehemals bekannte Vorkommen aufgewertet werden. Durch die Aufwertung und Pflege von schwer zugänglichen Feuchtbrachen sollten zudem Möglichkeiten geschafft werden, dass der Feuerfalter neue Lebensräume annimmt und sich wieder ausbreitet.
In den letzten 6 Jahren konnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. 65 ha Feuchtwiesen wurden gepflegt oder aufgewertet, oftmals mit adaptiertem Material wie etwa dem sogenannten Softrak. Die Maßnahmen müssen jedoch an die komplexen Lebensbedingungen des Falters angepasst werden. Eine frühe Mahd oder Beweidung ist schädlich für die Population, da Eier, Puppen oder Raupen oder deren Wirtspflanze, der Schlangenknöterich (Bistorta officinalis) in Mitleidenschaft gezogen werden. Ohne Maßnahmen fallen die Feuchtwiesen jedoch brach und die Futter- und Nahrungspflanzen werden verdrängt. Deshalb müssen die Gebiete auch immer wieder entbuscht werden, dies jedoch schonend, da die Art gleichzeitg Gebüsche, Waldränder, Hecken und Sträucher als Windschutz und Übernachtungsplatz benötigt.

Ein halboffener Lebensraum ist ideal für Lycaena helle, weshalb eine späte Rotationsmahd (alle paar Jahre wird abwechselnd ein Teil der Fläche gemäht) mit einer begleitenden motormanuellen Entbuschung sich als wirkungsvoll erwiesen hat. Alternativ oder begleitend werden die Flächen zudem beweidet, dies jedoch erst spät in der Beweidungssaison und nur für einen kurzen Moment – die Fläche wird dabei ebenfalls nie komplett abgegrast, so dass immer genügend Rückzugsmöglichkeiten für die Insekten verbleiben.

Um die Beweidung der Flächen zu gewährleisten wurden im Rahmen des Projektes auch 8,5 km Zaun gebaut. 1.250 Pflanzen wurden als Strukturelemente gesetzt, welche in Zukunft als Windschutz und Korridor dem Blauschillernden Feuerfalter bei der Ausbreitung helfen können. Dadurch profitieren auch Arten wie z.B. der Neuntöter.
Anhand eines Monitorings konnte die Präsenz des Blauschillernden Feuerfalters überprüft und die Akzeptanz der Maßnahmen kontrolliert werden. Durchschnittlich 25 Standorte, so genannte Transekte, wurden dreimal im Jahr während der Flugzeit des Schmetterlings zwischen Ende April und Anfang Juli kontrolliert. Im Rahmen eines Bestimmungskurses wurde zudem der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben dieses Monitoring in Zukunft zu unterstützen.

Der Blauschillernde Feuerfalter gilt als Zielart. Maßnahmen die zu seinem Schutz umgesetzt werden, wirken sich auch positiv auf andere Arten aus. So konnten im Projekt neue Kenntnisse über weitere Schmetterlingsarten wie Boloria eunomia oder Melitaea diamina gesammelt werden.
natur&emwelt Fondation Hellef fir d´Natur möchte sich bei allen Beteiligten (Umweltministerium, Natur- und Forstverwaltung, Wasserverwaltung, Firmen, Pächter, Anrainer, …), welche bei der reibungslosen Abwicklung des Projektes beteiligt waren, herzlich bedanken.